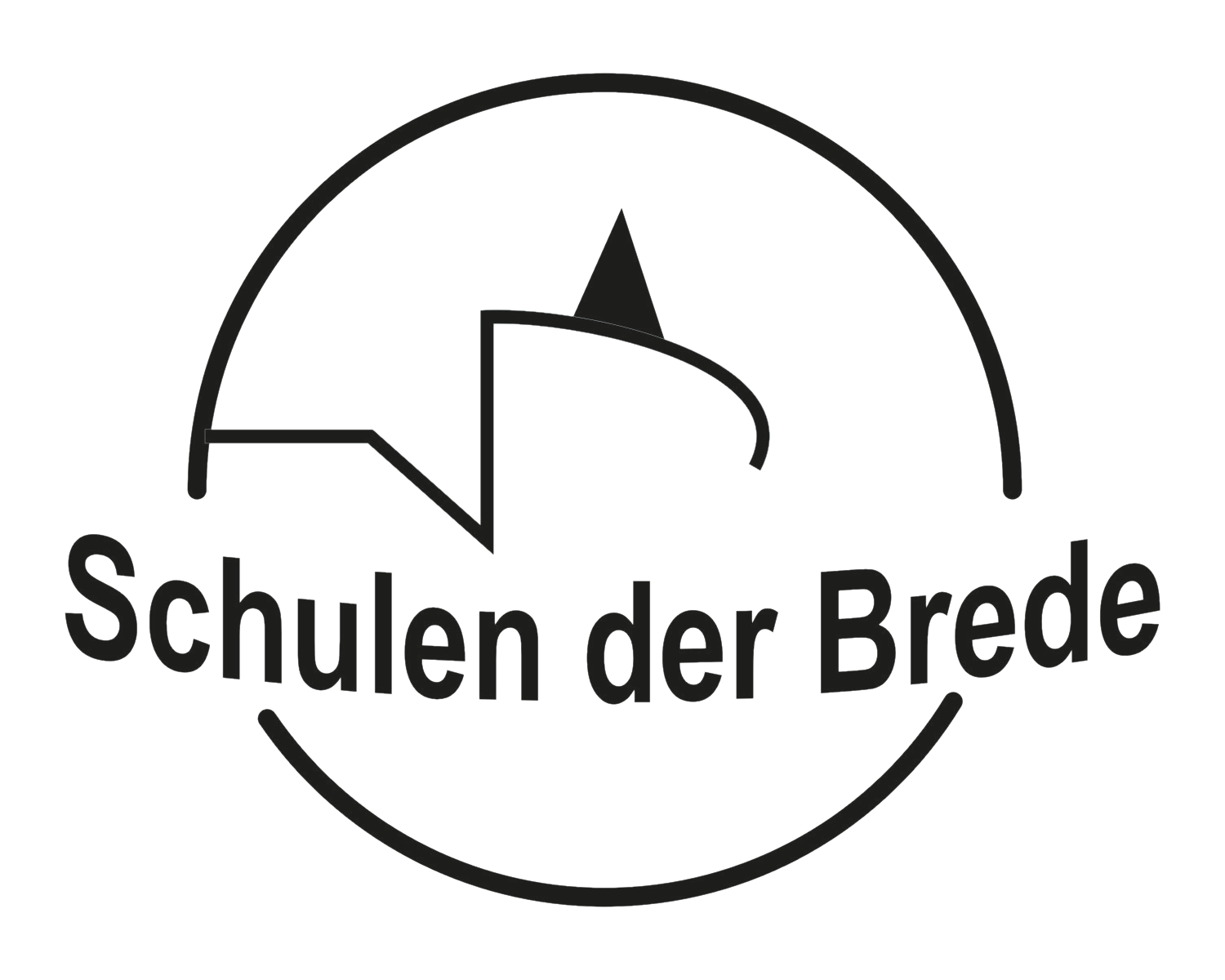Mit zwei Projekten geht das Gymnasium Brede in diesem Jahr am 29. Februar in Paderborn in den Wettbewerben „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ ins Rennen. Beide Beiträge möchten wir vorab auf unserer Homepage vorstellen. Den Anfang macht heute Hanno Wrenger aus der Q2, der sich im Bereich Physik dem zukunftsträchtigen Thema „Photovoltaik auf Basis eines Fluids“ gewidmet hat. In der nächsten Woche stellen wir dann den „Schüler experimentieren“-Beitrag von Johanna Grossebölting, Lena Lausberg und Vincent Albrecht aus dem Jahrgang 7 vor, die sich derzeit in der Rubrik „Arbeitswelt“ mit ihrem Projekt „Schaum im Wasser – eine richtig coole Sache“ beschäftigen.
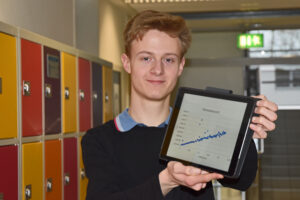 Hanno Wrenger geht mit einem sehr vielversprechenden Projekt an den Start: In den vergangenen Jahren hatte er sich bereits in verschiedenen Projekten mit der Untersuchung von Pflanzen beschäftigt. Vor zwei Jahren hat mit seinen Untersuchungen der Chlorophyllfluoreszenz den 2. Preis im Regionalwettbewerb Jugend forscht gewonnen. Dieser Erfolg brachte ihm noch eine weitere, für einen Schüler sehr seltene Auszeichnung: Er durfte über seine Forschungen in der angesehenen Fachzeitschrift „Chemie in unserer Zeit“ berichten!
Hanno Wrenger geht mit einem sehr vielversprechenden Projekt an den Start: In den vergangenen Jahren hatte er sich bereits in verschiedenen Projekten mit der Untersuchung von Pflanzen beschäftigt. Vor zwei Jahren hat mit seinen Untersuchungen der Chlorophyllfluoreszenz den 2. Preis im Regionalwettbewerb Jugend forscht gewonnen. Dieser Erfolg brachte ihm noch eine weitere, für einen Schüler sehr seltene Auszeichnung: Er durfte über seine Forschungen in der angesehenen Fachzeitschrift „Chemie in unserer Zeit“ berichten!
Aus diesen Projekten ist zuerst die Frage hervorgegangen, ob sich Exzitonen (Teilchen, welches bei der Fotosynthese auftritt) bei der Untersuchung von Pflanzenstress nutzen lässt. Diese Forschungen führten Hanno zu einer zweiten Frage: Lässt sich diese Begebenheit auch in flüssigen Solarzellen verwenden bzw. wie verhalten sich die Exzitonen in einer flüssigen Solarzelle?
Im Folgenden berichtet uns Hanno selbst ausführlich von seinen Untersuchungen:
„Um die Exzitonen in einer möglichen flüssigen Solarzelle möglichst gut untersuchen zu können, wurde anfangs ein Programm geschrieben, welches das elektrische Feld in einem Plattenkondensator mit einem Exziton visualisieren kann. Aus diesem Programm ist im Laufe der Zeit ein Programm hervorgegangen, welches ein Exziton, bestehend aus einem Elektron und einem Chlorophyll-Molekül, in dem elektrischen Feld eines mit Aceton gefüllten Kondensators simulieren kann. Dazu wurden die Kräfte, die durch den Kondensator und das Exziton ausgeübt werden, und mit ihnen die Beschleunigung, Geschwindigkeit und Position des Elektrons und des Ions berechnet.
Um die Wirklichkeit möglichst akkurat zu simulieren, wurden statistische Stöße in das Programm mit eingebracht. Aufgrund der statistischen Bestandteile der Simulation wurde eine Vielzahl an Exzitonen simuliert und am Ende die durchschnittlichen Endwerte für die Geschwindigkeit, Beschleunigung und Terminierungszeit ausgegeben. Bei der Auswertung dieser Werte wurde ein exponentieller Zusammenhang zwischen der Spannung, welche an dem Kondensator anliegt, und der Terminierungszeit beobachtet, welcher über die Funktion der statistischen Stöße als Reibungskraft erklärt werden kann. Der lineare Zusammenhang zwischen Spannung und Terminierungszeit bzw. Beschleunigung und Geschwindigkeit der Teilchen kann über die von der Spannung abhängende Kraft, welche der Kondensator auf die Teilchen ausübt, erklärt werden. Der lineare Zusammenhang zwischen der Größe des Flüssigkeitskörpers und der Terminierungszeit ist über die steigende Strecke erklärbar, die das Elektron durchschnittlich zurücklegen muss, um in den Kondensator eintreten zu können.
In den Messwerten wurde zudem noch ein Zusammenhang zwischen steigender Spannung und steigender Streuung der Werte beobachtet. Diese Begebenheit lässt sich über die höhere Anzahl der statistischen Stöße erklären, bei denen die Bestandteile des Exzitons mit Flüssigkeitsteilchen kollidieren, welche einen eingeschränkt zufälligen Impuls besitzen. Die durchschnittliche Anzahl der Stöße steigt mit steigender Geschwindigkeit und somit auch mit steigender Spannung.
Zwar sind flüssige Solarzellen nicht bzw. noch nicht so effizient wie feststoffbasierte Solarzellen, über eine mögliche dreidimensionale Ausdehnung besitzen sie aber das Potential, diesen Effizienzunterschied zu überbrücken. Alternativ lässt sich die Kombination aus einem Chlorophyllextrakt und einem Kondensator auch dafür verwenden, Pflanzenstress zu untersuchen. Dazu muss zunächst die relative Permittivität der Chlorophyll-Lösung bestimmt werden. Misst man nun die Stromstärke an dem Chlorophyll-Extrakt an dem eine Spannung anliegt, kann ermittelt werden, wie gestresst die Pflanzen sind, von denen das Chlorophyll stammt.“
Foto: Kai Hasenbein